Literaturwettbewerb 2020
#Wir - 5. Gautinger Literaturwettbewerb
Am Freitag, den 25. Juni 2021 fand die Preisverleihung zum 5. Gautinger Literaturwettbewerb im bosco, Bürger- und Kulturhaus statt. An diesem Abend wurde die Preisträger*innen bekannt gegeben, die die Jury – bestehend aus Luitgard Kirchheim, Andrea Pfannes, Anna Fichert, Sabine Zaplin, Gerd Holzheimer, Marc Schürhoff und Werner Gruban – aus den eingereichten Beiträgen zum Thema „#Wir“ ausgewählt hat.
Die Anzahl der Texte überstieg mit insgesamt 502 Einsendungen deutlich die Zahl der vorhergehenden Wettbewerbe. Mit Geburtsjahrgängen von 1930 bis 2013 ist das Feld der Teilnehmenden überaus vielfältig. Die Texte stammen aus dem gesamten Bundesgebiet, wobei rund 30 Texte aus den Landkreis Starnberg eingesendet wurden. 13 davon kommen direkt aus Gauting.
Die Texte wurden beim Literaturfest prämiert und in diesem Rahmen von Sprecherin und Schauspielerin Katja Schild vorgetragen. Musikalisch begleitet wurde der Abend von Halina Bertram am Klavier. Wie schon bei den vorherigen Wettbewerben gab es verschiedene Preiskategorien. Der Hauptpreis des Wettbewerbs ist mit 500 Euro dotiert.
Zugelassen zum Wettbewerb waren alle Textarten von Kurzgeschichten und Erzählungen über Gedichte und Mini-Dramen bis hin zu Monologen und allem, was es noch zu erzählen gibt. Vorgegeben war lediglich das Thema #Wir sowie eine Textlänge von maximal sechs Normseiten. Einsendungen waren bis zum 30. November 2020 möglich.
Grfödert von
AUFZEICHNUNG PREISVERLEIHUNG | #WIR | 5. Gautinger Literaturwettbewerb
Sehen Sie hier die Aufzeichnung vom 25. Juni 2021 auf YouTube.
Prämierte Texte des 5. Gautinger Literaturwettbewerbs
Lesen Sie im folgenden alle Texte, die im Rahmen des Literaturwettbewerbs ausgezeichnet wurden.
Wir gratulieren allen Preisträger*innen und bedanken uns für die zahlreichen Einsendungen zum Wettbewerb.
1. Preis: "Zyklop" von Jennifer de Negri
Ich nehme deinen Platz ein, mache mich breit, platt,
drücke meinen Bauch in den Sand, meine Brüste, mein
Becken. Den Kopf stütze ich auf, indem ich vor meiner
Nase einen Haufen zusammenscharre, ein Kissen aus Sand,
aufgeschüttete Dünendaunen, in die mein Kinn einsinkt.
Dann drehe ich die Schultern ein, lege die Arme ab, so
dass meine Handflächen zum Himmel zeigen. Ebenso
verfahre ich mit Schenkeln, Knien, Schienbeinen,
Fußrücken. Bis auf Gesicht und Hals übt mein Körper nun
den maximal möglichen Kontakt zu seinem Untergrund aus.
Diese Position ist unbequem, der Nacken überdehnt. Die
Haut über den Schlüsselbeinen wird durch den Druck
meines Gewichts aufgerieben. Mein Schambein pocht, weil
ich es mit Gewalt zu Boden presse. Morgen werde ich
Schmerzen haben, Sand an unmöglichen Stellen,
Blutergüsse. Aber das macht nichts. Ich bin allein. Ich
kann mich verhalten wie ich will, aussehen wie ich
will. In diesem Moment bin ich ein Walross. Die
Hautfarbe ist ein Problem. Wäre ich am Toten Meer,
hätte ich mich mit Schlamm eingerieben, so wie du mich
dort mit Schlamm eingerieben hast. Ich bin ein
rosafarbenes Walross, das darauf wartet, dass du seinen
Rücken einschmierst, zumindest mit Sonnencreme. Wärst
du jetzt hier, würde ich mit meinen Armen und Beinen in
den Sand schlagen, als wären meine Glieder Flossen und
dazu gutturale Laute von mir geben. Du findest so etwas
lustig. Entlang meines Nasenrückens rollt ein
Schweißtropfen, bleibt an der Spitze hängen. Mit meinen
Wahl-Walross-Augen sehe ich mich darin gespiegelt.
Zweimal, viermal, sechzehn Mal ich. Der Tropfen könnte
auch eine Träne sein. Unendlich Mal ich. Ich atme so
tief Luft in meine Lungen ein, wie das in meiner Lage
möglich ist, und puste die Schweißträne in den Sand.
Du läufst an dem blassen Band entlang, das sich vor
deinen Augen in die Länge zieht. Um diese Jahreszeit
sind kaum Menschen am Strand. Dafür machen sich Sisal-
Agaven an den Rändern der Dünen breit, die
sternförmigen Sukkulenten strecken ihre Stacheln aus.
Landeinwärts stechen Drachenbäume in den Himmel und in
einiger Entfernung wuchern mit Gift beladene
Oleandersträucher durch die Landschaft, zackige Palmen,
Grasbüschel. Sonst ist da nur Sand und unter dem Sand
Schichten von Lava, von Asche. Asche, die einmal Leben
war. Vereinzelt nimmst du ein Paar Knie wahr, die wie
Türme über Sandhaufen ragen, die man hier zum Schutz
gegen Wind aufschüttet. In deren Umkreis sind Badegäste
damit beschäftigt, Wasser aus dem Meer in Flaschen oder
Hände zu füllen, um es über einem der Haufen
auszuschütten. Alle zehn bis zwanzig Minuten wird der
Sand an der Oberfläche durchgetrocknet sein und
verwehen. Es ist ein Ritual unter den Kennern der
Insel. Seit Jahren macht ihr hier Urlaub. Jeden
November findet der Bus an derselben Stelle im Schatten
der Bäume Platz. Zwischen die Äste hängst du eine
Hängematte, am Boden platzierst du Tücher, daneben zwei
Liegestühle aus Holz. Hinter dem Wagen wuchten sich
Gesteinsbrocken in die Höhe, vorne liegt der Horizont.
Da ist Afrika, denkst du manchmal, als hätte dich
jemand gefragt.
Ich sehe dich von Weitem. Du bist ein schiefer Schatten
gegen das Licht. Du läufst vornübergebeugt, weil du
nach Muscheln Ausschau hältst, oder nach hinten
gekippt, weil du den Himmel absuchst, ich weiß nicht,
wonach. Dein Schatten wirft einen weiteren schiefen
Schatten auf den Strand, das kann ich erahnen. Du bist
vertikal, wo die Landschaft sich in Horizontalen
übereinanderlegt: Das Meer, die Wellen, der Strand, die
Dünen, darüber die Hochebenen. Du bist auffällig. Das
gefällt mir an dir. Du weißt das, hast dich darum
bemüht, dass es so bleibt. Meine Haut verbrennt in der
Sonne. Ich sollte mich umdrehen. Was macht ein Walross
in so einem Fall? Die Schwanzflosse in den Boden
rammen, sich mit einem Ruck zur Seite rollen. Einatmen,
ausatmen. Flossen rudern durch die Luft. Plötzlich
liege ich auf dem Rücken. Das Handtuch fühlt sich kühl
auf meiner Haut an. Morgen werden sich Blasen zu den
Blutergüssen gesellen. Ich drehe den Kopf hin und her,
entspanne den Nacken. Keine Sterne am Himmel jetzt.
Dein für mich nicht sichtbarer Schatten am Strand.
Das Meerwasser wird mit jedem dritten Schritt vor
deinen Füßen angespült, färbt den Boden dunkel,
versickert, blubbert aus Löchern, die an Einschüsse im
Sand erinnern, der durch mehrere Tonphasen hindurch zu
seiner ursprünglichen Färbung zurückkehrt. Das Wasser
verschwindet, lässt außer einem Salzrand nichts zurück.
Löst sich auf, denkst du, wie Tinte auf Löschpapier. So
wirst du aufgesogen werden in einem Schwamm aus Zeit.
Und ebenso eure verzweifelten Gespräche, die bleibenden
Worte, die in die Abendluft zwischen Zedern drängen.
„Nächstes Jahr werde ich nicht mehr dabei sein.“
„Lass uns Sternbilder suchen, wie jedes Jahr. Nach
sechzehn Treffern höre ich meistens auf. Du schläfst
bei fünf ein.“
„Ich frage mich, ob du hierher kommen wirst? An unseren
Strand.“
„Oder lass uns Zikaden zählen. Noch besser:
Glühwürmchen!“
„Oder ob du woanders reisen wirst?“
„Da ist das W. Kassiopeia!“
„Ich hoffe, du lernst jemanden kennen.“
„Weißt du noch? Südostasien, das Kreuz des Südens?
Schade, dass man das hier nicht sehen kann.“
„Ich weiß, dass du das nicht hören willst. Aber wir
können nicht so tun, als wäre alles wie immer.“
„Jetzt ist alles wie immer. Wie viele Sterne gehören in
das Sternbild der Kassiopeia? Außer den fünf
Hauptsternen?“
„Kassiopeia war schöner als die Nereiden, das weiß ich,
und die Mutter Andromedas, die von Perseus vor dem
Seeungeheuer gerettet wurde.“
„Vor der Medusa?“
„Nein, die war später dran. Perseus hat alle besiegt.“
„Ein Kämpfer.“
„Ja, mit Sicherheit ein echter Held.“
„Vielleicht könntest du…?“
„Bitte fang nicht wieder davon an.“
„Ich kann es mir einfach nicht vorstellen -“
„Siehst du die Milchstraße? So unendlich viele kleine,
weiße Punkte -“
„Dass du nicht kämpfen willst!“
„Wie meine Leukozyten.“
Das Walross ist eingeschlafen. Wir träumen gemeinsam,
mein Walross-Ich und ich, von Fisch, von früher. Einmal
hast du mir etwas von deinem Strandspaziergang
mitgebracht. Du hast es vor mir auf den Boden geworfen.
Ich las gerade ein Buch, Sandkörner stoben zwischen die
Seiten. Du hast dich neben mich gesetzt und gesagt, ich
müsse das ansehen. Widerwillig habe ich den Rucksack
angefasst, der nass und durchweicht war. Sein
Reißverschluss gurgelte beim Öffnen. Im Inneren war ein
Knäuel Kleidung in einer Plastiktüte, vollgesogen mit
Salzwasser, irgendwelche Papiere, abgeklebt, aber
unleserlich, ein Papiermatsch. Dann war da noch eine
Art Kralle oder gebogenes Stück Horn. Du lagst neben
mir, hast mit einer Hand meinen Rücken gestreichelt,
oder bilde ich mir das ein, vielleicht war es mehr ein
Rütteln an meinen Schultern. Also habe ich mich
hingelegt, an deine Seite, zu dir, in dich hinein. Der
Rucksack stank, nach Algen, nach Schweiß. Ich ließ ihn
am Strand zurück, redete mir ein, er sei ein Zeichen.
Für die Anderen. Ich war feige. Abends liefen wir die
paar Kilometer in den Ort, aßen frittierten Fisch,
hörten Radio, hörten, was wir erwartet hatten. Du hast
nichts gesagt, hast geschwiegen, auch am nächsten Tag.
Jetzt stehst du still. Dein Körper ist dem Meer
zugewandt, die Zehen sind unter Wasser, Fersen im Sand.
Vor dir liegt Afrika. Es gibt diese Stelle, wo der
Strand plötzlich endet, weil die Küste eine Biegung
macht. Dort stößt du auf Felsformationen, verwinkelte
Schluchten, Steilküste. Du überwindest die Klippen,
steigst immer höher hinauf. Aber irgendwann kehrst du
zu deinem Ausgangspunkt zurück. Weil die Insel eine
Insel ist, ein Strand, der sich um sich selbst dreht.
Wenn du nicht in Bewegung bist, nicht Meter für Meter
versuchst, Distanz in Nähe umzuwandeln, wirkt der
Strand viel weiter. Dann ist er kein Streifen, sondern
eine Fläche. In einer Fläche kann ein Mensch
verschwinden. Die Pflanzen, die Agaven, Palmen, die
Drachenbäume sind nebensächlich. Die Knie, die Haufen,
der Sand, die Asche sind nebensächlich. Strand und Meer
sind immer in Bewegung, sind Vergangenes und Gegenwart.
Vor dem Verschwinden wendest du dich um, blickst zu mir
herüber. Weil du den Kopf gedreht hältst, das Kinn über
die Schulter, teilt Licht dein Gesicht in zwei Hälften.
Der scharfe Rand eines Schattens verläuft über deiner
Stirn an der Nase entlang nach unten. Ein Auge ist im
Licht, das andere unsichtbar. Wo Licht und Schatten
sich treffen, bildet sich ein drittes Auge. Ich frage
mich, ob es möglich ist mit diesem Auge zu sehen. Ob du
damit das Walross erkennen kannst, von oben, wie im
Film. Ich würde dich das gerne fragen, doch du bist ja
nicht mehr da.
2. Preis: "Lockdown" von Peter Friedrich
Immer und immer wieder trippelte die Fliege an dem erhöhten
Rand des Dosendeckels entlang im Kreis – als sei sie in einem
unendlichen Labyrinth gefangen.
Gulaschsuppe, feurig-scharf – so viel konnte Robin schon lesen.
„Verehrte Gäste, wir möchten Sie darauf hinweisen, dass unser
Geschäft in zehn Minuten schließt.“
Das Zerren der Mutter an seiner Hand wurde schmerzhaft.
Offenbar hatte sie genügend Dosen in den Einkaufswagen
geworfen, wollte weiter. Sie waren in Verzug. Immer, wenn diese
Durchsage kam, mussten sie eigentlich schon bei den
Tiefkühltruhen mit den Fertiggerichten sein. Ruckartig zog die
Mutter an seinem Arm. Er stemmte sich dagegen, starrte weiter die
Fliege an. Plötzlich blieb diese stehen und putzte die Augen. Strich
die Vorderbeine abwechselnd über die metallisch schillernden
Halbkugeln, bis die Fliege sich unvermittelt drehte und seinen Blick
zu erwidern schien. Wie eine stolze Königin, die ihn herablassend
taxiert, saß die Fliege auf der Dose, ihrem goldenen Thron.
„Wir möchten Sie bitten, sich jetzt zu den Kassen zu begeben.
Unser Geschäft schließt in wenigen Minuten.“
Träge tröpfelte die Durchsage in die Stille, welche die Fliege
umgab. Sie standen doch nicht schon zehn Minuten hier vor dem
Regal mit den Dosensuppen? Hatte seine Mutter ihn einfach
stehen lassen? Der Schmerz in seiner im eisernen Griff der Mutter
steckenden Hand verneinten diese Frage. Robin riss sich vom
Anblick der Fliege los und blickte sich um. Er wunderte sich mehr
als dass er erschrak. Zu oft hatte er in den wenigen Jahren seines
Lebens schon rätselhafte, magische Dinge erlebt, welche die
Erwachsenen nicht im Mindesten zu beunruhigen schienen. Seine
Mutter stand in weit ausholendem Schritt da, doch sie war wie
eingefroren. Wie tot, nur ohne umzufallen.
Das Kribbeln in seiner eingequetschten Hand wurde
unerträglich. Mit der freien Hand packte er die der Mutter – sie fühlte
sich wie Hartplastik an – und zog die umschlossene Hand mit
einem kräftigen Ruck heraus. Er ging um seine Mutter herum. Ihr
Kopf war seitwärts nach oben gedreht, die Augen auf eine Packung
Bolognese-Fix geheftet. Er schlug mit der Hand gegen das Bein der
Mutter. Ein kurzes, flaches Klatschen ertönte. Er beschloss,
jemanden zu suchen, der Bescheid wüsste. Hier im Supermarkt,
wo es, wie seine Mutter immer sagte, alles gibt, musste es
jemanden geben, der Bescheid wusste. Er tapste in den Mittelgang,
doch auch hier: Überall nur steife Menschenkörper.
Ein dicker Kloß kroch in Robins Hals nach oben. War das eine
neue Art Corona-Lockdown? Beim ersten Lockdown hatte seine
Mutter ihm erklärt, dass man das gesamte Leben ‚herunterfahren‘
müsse, um diese komische Krankheit zu stoppen. Herunterfahren –
so wie sie ihren Computer herunterfahren musste, bevor sie ihn
ausschaltete. Obwohl der Computer da nirgendwo hinfuhr.
Allenfalls der Deckel wurde heruntergeklappt. War diesmal das
gesamte Leben nicht nur heruntergefahren, sondern ganz
ausgeschaltet worden? Nur er als kleines Kind war nicht betroffen,
weil – bei kleinen Kindern war dieser Corona nicht so schlimm?
Er schlängelte sich zwischen Körpern und Einkaufswagen
hindurch, drehte sich suchend im Kreis, stolperte gegen
einen älteren Herrn, der seine Armbanduhr fixierte. Aus dem Augenwinkel
registrierte er, wie sich ein übergroßer Kopf bewegte. Der Kopf des
schlecht rasierten Mannes wurde in den Nacken geworfen und der
Mund zu einem lauten Lachen aufgerissen, ohne dass das Lachen
zu hören war. Er rannte auf dieses Gesicht zu, schlängelte sich um
vier steife Personen und sah plötzlich das lachende Gesicht
vervielfältigt. In zahllosen neben- und übereinander stehenden
Fernsehbildschirmen schüttelte der Mann den Kopf, lachte und
lachte, doch der Ton der Fernsehgeräte war ausgeschaltet.
Robin bekam Angst vor diesem lautlosen Lachen. Ruckartig
wandte er sich ab und wollte den Ausgang suchen, lief kreuz und
quer durch die Regalreihen, stieß gegen Schokopop-Packungen,
auf denen in Rot die Buchstaben XXL prangten, stolperte gegen
einen Wühltisch, in dem zahllose Gegenstände – alle für nur 1 Euro
– lagen, wurde von Werbefähnchen, die aus den Regalen
herausragten und 15% mehr Inhalt versprachen, ins Gesicht
geschlagen, während eine – diesmal männliche – Stimme eine
unschlagbar günstige Flatrate und eine viermal schnellere
Übertragungsrate anpries. Er geriet ins Taumeln, die Reis- und
Spaghettipackungen, die Marmeladengläser und Shampoo-
flaschen, die Energy-Drinks und Katzenstreusäcke wurden größer
und größer in den wolkenkratzerhohen Regalen, er stürzte durch
die enger werdenden Schluchten, bis er schließlich gegen eine
Tiefkühltruhe prallte. Er erkannte eine Packung Curry-Reispfanne.
Genau die sollte es gleich nach dem Einkauf geben. In der
Mikrowelle dauerte das keine zehn Minuten. Er fuhr er mit dem
Zeigefinger über die Kante der Tiefkühltruhe. Der Finger schob
einen stetig anwachsenden Berg Staub vor sich her. Robin stutzte.
Auch die Menschenfiguren um ihn herum waren mittlerweile von
Staub bedeckt. Nicht nur dass: der Putz an den Wänden hatte
Risse und Blasen. Zwei Meter vor ihm rieselte ein Stück Putz von
der Decke. War das normal, wenn das ganze Leben ausgeschaltet
wurde? Warum hatte seine Mutter ihn nicht im Kindergarten
gelassen? Irgendjemand musste sich doch um ihn kümmern.
„Wir danken Ihnen für Ihren Besuch und wünschen Ihnen einen
schönen Abend.“
Wenn das Geschäft jetzt schloss – vielleicht ging das ja
vollautomatisch – müsste er die Nacht in diesem verfallenden
Supermarkt verbringen. Robins Herz schlug schmerzhaft gegen
seinen Hals. Er rannte den Mittelgang entlang, quetschte sich an
Einkaufswägen und Plastikstatuen vorbei, bis er vor einer Kasse
stand. Die in ihrem Stuhl klebende Kassiererin und eine junge
Kundin bildeten mit ihren Armen eine Schranke über dem
Laufband. Ihre Hände verbunden über ein paar Geldscheine. Auch
die toten Blicke der beiden vereinigten sich auf den Geldscheinen
und wie alle anderen trugen sie bereits eine dicke Mütze aus,
bröseligem Staub. Er kletterte auf das Laufband, stieg über die
ausgestreckten Arme, sprang auf den Boden und rannte zum
Ausgang, wo sich die beiden Glasscheiben in stummer Ergebenheit
auseinander schoben. Aber auch hier unter freiem Himmel: alle
Menschen starr und steif. Überall Müll. Fetzen von Papier und
Plastiktüten, verblasste Werbeprospekte, Erde, Dreck, verwelktes
Laub. Als würde diese neue Form des Lockdowns schon Monate
andauern. Am Ende des Parkplatzes sah er eine Ampel, die von
Rot auf Grün schaltete. Davor sechs Autos, verwitternden
Felsbrocken gleich. Überall abgeplatzter Lack und Rostflecken, die
sich wie Flechten auf den Karosserien verteilten. In den Autos von
all dem gänzlich unbeeindruckt wirkende Menschenfiguren.
Er hockte sich auf den Boden und beschloss zu warten, bis
seine Mutter käme, bis irgendetwas geschähe. Er kannte sich doch
nicht aus mit so was. Er zog die Knie fest an die Brust und steckte
den Kopf zwischen die Beine. Monoton schaukelte er seinen
Oberkörper vor und zurück, als er auf einmal eine leise
Frauenstimme hörte. Robin hob den Kopf, stand auf, ging –
zunächst ängstlich – die Straße entlang. Dann trabend, schließlich
laufend, rennend, keuchend diesem lockenden Sirenengesang
nach. Dort war jemand. Ein Erwachsener. Er war nicht mehr
alleine. Aus einem Autos, das vor einer Ampel stand, kam die
Frauenstimme. Es klang, als gäbe die Frau in freundlichem Ton
Anweisungen. Vielleicht eine Polizistin, die endlich begann, dies
Ganze wieder in Ordnung zu bringen! Oder vielleicht sogar eine
seiner Kindergärtnerinnen! Vielleicht Silke, oder Christine! Das
Fenster der Beifahrertür war geöffnet. Außer Atem streckte er
seinen Kopf durch die Fensteröffnung.
„Nach zweihundert Meter biegen Sie rechts ab.“
Am Steuer saß gar keine Frau, sondern ein regloser Mann. Ein
sehr alter Mann. Ein an die Windschutzscheibe geklebtes
Navigationsgerät blinkte. Seine Mutter hatte auch so ein Ding,
damit sie bei ihren Geschäftsterminen keine Zeit mit der
Straßensuche verlor. Im Urlaub durfte er damit spielen und eine
finnische, englische oder gar japanische Stimme einstellen. Es war
ihm stets ein unheimliches Rätsel geblieben, dass ein Finne, ein
Engländer, ein Japaner in diesen unverständlichen Klangfolgen
einen Sinn erkennen können sollte. Diesmal verstand Robin zwar d
ie Sprache der Stimme, aber sie gehörte niemandem. Als er sich
aufrichtete, sah er in dem gläsernen Gebäude gegenüber ein Band
aus leuchtend roten Punkten unten am Fenster entlanglaufen. Die
Punkte gruppierten sich zu Buchstaben und Zahlen.
…DAX +1,31%...DOW JONES -2,04%...NASDAQ 100 -2,51%...
Robins Pupillen huschten hin und her, um den davonlaufenden
Zeichen zu folgen, um die Abfolge von Buchstaben, Zahlen und
Zeichen zu entschlüsseln. Doch er fand in diesem Wirrwarr keinen
Hinweis darauf, was er tun solle. Wenn dies Anweisungen für den
Notfall sein sollten, so waren sie nicht für ihn gedacht.
Robins Herz pochte immer schneller. Er trottete um die nächste
Ecke. Auf einem begrünten Platz setzte er sich auf eine Bank unter
einem Ahornbaum. Beim Hinsetzen pflückte er absichtslos einen
Ahornsamen. Während er mit leeren Augen auf den Boden starrte,
spielten seine Finger mit dem Ahornsamen. Die Finger kannten
dieses Spiel von selbst, hatten es noch am Nachmittag im Hof der
Kita gespielt. Mit dem Fingernagel des Daumens spalteten sie das
dicke Ende des geflügelten Samens, bogen die beiden noch
grünen Spalten auseinander und klebten die so erhaltene Klammer
auf seinen Nasenrücken. Da stutzte Robin. Er nahm den Samen
von der Nase. Der Samen war weich. Auch das Gras zwischen
seinen Füßen – es war weich. Die Pflanzen waren von dem
Lockdown nicht betroffen! Er schaute rings umher in das dunkle
Grün der Büsche, bis sein Blick von einem etwa walnussgroßen,
weißlichen Fleck und einem vor diesem hellen Fleck hin- und
herpendelnden winzigen Etwas eingefangen wurde.
Er näherte sich dem Busch, bis der Fleck sich dicht vor seinen
Augen befand. Es war ein kugeliges, weißes Gespinst, mit
Seidenfäden an der Basis eines Blattes befestigt. Das pendelnde
Etwas eine Spinne, die, sich ständig im Kreise drehend, ihren
faltigen Hinterleib in gleichmäßigen Abständen sanft auf die
Gespinstkugel tupfte. Robin schrie nicht auf, wie er es sonst tat,
wenn er eine Spinne sah. Diese hier saß nicht in einem Netz und
lauerte auf Beute. Sie behütete und schützte etwas im Inneren des
Kokons, den sie dort gerade spann.
Im Innern des noch transparenten Gebildes sieht es gelb und
warm aus. Robins Augen weiten sich. In der Mitte des Kokons sind
Eier. Gelbe, winzig kleine Eier. Stumm und bewegungslos – aber
eng und zärtlich aneinander geschmiegt, sanft geschaukelt von der
Spinnenmutter. Den Blick auf die warmen, sich still betastenden
Eier in dem zarten Gespinst gerichtet, zeichnet sich ein ängstliches
Lächeln ab auf Robins kindlichem Gesicht.
3. Preis: "EINHUNDERT TAGE" von Marlies Pahlenberg
Wir ziehen Kreise in diesem kleinen Haus, was zwischen zwei anderen klemmt, in denen angeblich Nachbarn leben. Du und ich sind Darsteller im gleichen Film und spielen treu unsere Rollen. Im Warten vergessen wir auf was eigentlich.
Die Luft ist so dick, dass eine Bewegung Wellen hineinschlagen würde und die Treppe hoch ist eine Tagesaufgabe.
Unsere Blicke werden von roten Gardinen im Zaum gehalten. Ich weiß, dass dahinter ein hellblauer Himmel auf eine Kokospalme drückt, aber ich weiß nicht, woher diese ihre Kräfte nimmt, trotzdem zu stehen.
Auf der anderen Seite ist die Wand, auch hellblau. Sie drückt meinen Blick zurück zu mir.
Diese Wand hat nie mehr getragen als ein Bild von einem übermalten Mann.
Staub löst sich von den Wänden aus nacktem Beton. Das Fenster kann man bald mit bloßen Händen rausreißen, die Tür eintreten, und es gäbe monatelang keinen Ersatz.
Die Luft hat Fieber und steht. Wir nehmen einen Kamm und ziehen sie in Strähnen.
Der Wasserhahn tropft so zart wie eine leichte Glocke.
Vom Bad zur Küche drücke ich mich durch die Luftmasse und ruhe mich dann auf dem Sofa aus. Beim Hinlegen stellt sich mein Körper tot, um nicht von der Hitze erschlagen zu werden. Meine Beine bilden zwischen sich einen klebrigen Saft. Sie lassen sich nicht mehr trennen und ich bleibe noch etwas liegen. Dieser Saft enthält meine Vitamine, die langsam ins Sofa einziehen und es mit einem süßlichen Geruch einfärben.
Ich bringe wieder einen Tag um die Ecke, murkse ihn ab. Ich habe mit ihm gerungen im Wohnzimmer und in der Dusche. Er hatte mich schon im Schwitzkasten. Jetzt knie ich auf ihm und bleibe dort sitzen, bis jedes Leben und jedes Licht pünktlich zum 21 Uhr Applaus aus ihm gewichen ist.
Du schaust draußen stillen Gewittern zu, ich schleiche mich an.
Nach dem Regen fliegen hunderte Fliegeviecher ins Haus und verlieren ihre Flügel auf dem Bett. Sie lassen uns zwischen unendlich vielen schimmernden Flügelpaaren zurück und wir können sie uns trotzdem nicht anziehen.
Ich mag es, wenn du still bist.
Wie ein Baby, das man mehr liebt, wenn es nach langem Schreien endlich der Stille den Raum überlässt.
Wenn du schläfst, kannst du mir nicht ins Wort fallen.
Die Gewitter, die seit Stunden um uns kreisen, sind ganz still. Keine Donner, nur lautlose Blitze, die durch ihr helles Licht versuchen, die Dramatik eines dröhnenden Gewitters nachzuahmen.
Diese Blitze bekommen keine Antwort, die sich von ihrer eigenen Frage unterscheidet.
Alles kreist rastlos um sich selbst, sucht nach Anhalt, nach einem Gegenüber, ohne welches alles zerfließt und auseinander läuft wie ein zu früh umgestülpter Pudding. Wie ich, die nicht durch eine Umarmung zusammengehalten werde.
Du schläfst und ich trau mich nun ganz nah an dich ran. Wenn du träumst, bist du auch nicht weiter weg als sonst.
Du wirst jetzt nichts Unvorhersehbares tun und nichts im Haus verrücken. Du lässt jetzt alles so wie es ist und die einzige, die sich bewegt, bin ich und achtzehn Insektensorten, die mit uns dieses Haus teilen.
Uns uns.
Uns klingt wie die erste Silbe von einem maßgeblichen Wort, was ich vergessen habe aber welches mir Antworten auf meine Fragen geben könnte.
Hast du die Silben getrennt und neu geordnet, als ich kurz weggeguckt habe? Als du alles umgeräumt hast?
Hast du hast du. Du hast hier umgeräumt. Ein Zimmer hat schon komplett deinen Geruch. Du hast jeden Gegenstand gehoben, verstellt, zu deinem erklärt. Hast mir jeden Gegenstand ausgespannt, hast lüstern den Kabeln hinterher geglotzt und erst den Blick abgewendet, als sie ganz in der Wand verschwunden waren.
Erst dann hast du wieder Appetit auf mich bekommen, dir deine Kochmütze aufgesetzt und meine Beine gespreizt. Ich kam wütend hinter dir her. Die Blitze entluden sich in orgasmische Traurigkeit und dann ging ich runter.
Der ganze Schrott ist jetzt unter meinem Bett.
So sieht man ihn nicht mehr, schläft nur drauf
und du willst Lob dafür haben.
Soll ich dich jetzt verlassen oder erst bald?
Im Keim ersticken ist zu spät.
Ist schon aufgekeimt mit Fingernägeln und Darm.
Jetzt noch tottreten wäre bereits eklig, wie wenn ein Insekt so groß ist, dass es beim Sterben knackt.
Du räumst auch im Garten um. Die trockenen Blätter lässt du mir auf dem Weg liegen.
Wir sind so klein, so nah am Nervenzusammenbruch. So nah am Prügeln mit Toten. Und jetzt verschwinde. Das Au Ja zum Leben ist schon wieder hinter dem Aua Hau Ab verschwunden. Du fährst eine Runde Fahrrad, kommst mit einem Platten zurück und ganz viel Energie zum Räumen.
Du umzingelst mich, kommst aus den Ecken, von oben und aus dem Abfluss. Du hast eine Armee aufgestellt, die langsam dieses Haus bevölkert, meine Bilder gegen deine austauscht, meine Träume gegen deine.
Aber das ist nur Wachstumsschmerz.
Unsere Leben haben sich noch nicht haltbar ineinander verhakt, wir sind immer noch jeder auf seiner Seite.
Den dritten Abend in Folge rede ich von Ziegenkäse, Lasagne, Schuhen und Schmuck. Alles noch schnell vor Ladenschluss.
Ich schlafe zwischen Insektenflügeln ein und träume, dass ich fliegen kann, wenn ich meine Hände nur richtig halte.
Und dann zum hundertsten Mal aufwachen auf dieser kahlen Betonbühne ohne Zuschauer, auf der ich einen neuen Tag spielen soll. Ohne Skript, ohne Requisiten, ohne Dialog.
Und mir fällt schon beim Frühstückmachen nichts ein.
Wieviel Unterhaltung geben drei Zutaten her?
Mit den Nachbarinnen am Zaun reden, bis sie kariert werden und mit dem Maschendrahtzaun verschmelzen?
Der einzige Soundtrack ist das ewige angestrengte Rauschen des Ventilators. So als hätte mir jemand beide Trommelfelle geohrfeigt. Er bewegt die gleiche Luft von A nach B und täuscht Bewegung vor. Auch die tanzenden Gardinen werden eigentlich im Loop abgespielt, wenn man genau hinsieht.
Du hast heute auch das Wohnzimmer umgeräumt. Auf dem Sofa sitzt es sich nun wie im Wartezimmer mit Blick auf die Tür und mit Illustrierten in Greifnähe.
Man lehnt sich nun nicht mehr an, man sitzt gerade und sieht sich dabei gerade sitzen. Sieht sich warten und fragt sich worauf.
Es ist nun sehr ordentlich. Dinge sind an ihrem Platz und bei ihresgleichen.
Auch die Donner haben sich feinsäuberlich von den Blitzen getrennt und woanders aufgestapelt. Weiß Gott, wo? Weiß er, weiß er.
Diese Unordnung. Du sagst du ordnest nur um, aber beim Schrubben ist dir ein Stück aus dem –m gebrochen. Ist dir aber egal. Du hast es ja auch nicht mit deinem Kind gebastelt.
Ich will dich erschrecken. Ein Donnerwetter für so viele Blitze, die du mir am Himmel gezeigt hast, als würden sie nur mich betreffen, als müsse ich endlich die Verantwortung für sie übernehmen.
Aber bei dem Versuch dich zu erschrecken, habe ich mir selber den größten Schrecken eingejagt.
Hinter jeder Ecke erwarte ich ein neues Insekt, was sich in meinen Weg stellt und mich zum Morden zwingt. Wenn du da bist, sollst du das machen.
So viele Fabelwesen.
Der Hund hat auch irgendwas huschen sehen.
Das Schlafzimmer dröhnt wie eine Flugzeuglandebahn. Die Ventilatoren schleudern heiße Luft in unsere Augen und spielen Sandmännchen. Gute Nacht, schlaf schön, brülle ich.
Ich geh ins andere Zimmer und lass mir meine eigene Luft um den Kopf schleudern.
Sollen die Tiere doch kommen.
Hier liege ich in deiner Umordnung und befriedige mich selbst. Die Zuschauer hocken in allen Ecken, auch von oben aus dem Insektennetz glotzt ein Viech auf meine Vulva.
Vielleicht geh ich danach zurück zu dir und lege mich auf deine Schulter.
Du kannst ja auch nichts dafür, dass dir was zerbrochen ist, was nicht dir gehörte. Das Viech über mir ist eine Fliege, die sich im Netz verfangen hat. Ich könnte sie jetzt totschlagen, will mir aber die Hände nicht schmutzig machen.
Der Nachthimmel ist erleuchtet von den weißen Wolken oder dem Mond, der irgendwo ganz groß sein muss. Das Mantra schiebt die Wolken eine nach der anderen die Fenstergitter entlang. Da ist eine Frau, die auf dem Rücken schwimmt und da gleich noch einmal in Nahaufnahme. Da ist ein Fisch, der beim Vorbeiziehen etwas Großes verschluckt.
Die Restaurantszene im Film hat uns hungrig gemacht und wir sind nochmal runter geschlichen und haben im Dunkeln Marmeladenbrote gegessen. Dieser Moment war wunderbar. Ich habe dann eine Kakerlake unter der Küchenzeile gesucht und auch gefunden.
Jetzt ist das Licht wieder an. Jeder Tropfen, der vor dem Fenster Schnüre zieht, ist beleuchtet. Die Blitze kommen von überall her, stürzen um mich herum in den Boden und die Donner haben sich zu einem dröhnenden Teppich verknüpft. Es ist ein lustvolles Brüllen, das ein Ende ankündigt.
Heute ist Sommeranfang, obwohl es schon seit einem Jahr heiß ist.
Die Hündin nebenan gebärt neun rattenartige Geschöpfe. Ihr Körper krampft sich zusammen, ein Schwall dünnflüssiges Blut und noch ein neues Leben schwappen heraus. Ich gucke auf meinen eigenen Bauch. Wer braucht dieses ganze Leben?
Abends kommt auch kein Lüftchen.
Der Ventilator strengt sich so an, dass er heiß läuft, bevor der Raum abkühlen konnte. Dem Essen kann ich beim Verwesen zusehen. Und ich weiß nicht wie irgendwas mit Fell hier überleben kann.
Ich bin seit neunzig Tagen zu Hause mit dir. In dieser Zeit wurden 11 Hunde geboren und 4 Katzen. Die 4 sind gestorben, die Hunde leben und wechseln sich mit den Zitzen ab. Das Kind in mir wächst und möchte auch gesehen werden.
Ich lese Liebesgedichte und denke: So hab ich auch mal gefühlt. Ich kleines weißes Wesen im tosenden Wellenschlag, der mir den Bikini von der Brust reißt. So intensiv, so schwankend, und wie schön das dann immer in Gedichten klingt.
Jetzt ist meine Liebe anders. Ich sitz eher an der Bar und guck aufs Meer und die Strömungen sind mir ganz egal. Es zieht sich zu und ich stell meinen Drink unter ein Vordach, damit er nicht verwässert. Das kann auch Liebe sein.
Alles ist anders seit ich im Krankenhaus geschrien habe. Seitdem kann nichts mehr leise sein. Meine Haut ist weich, mein Bauch darf sich endlich nach vorne lehnen.
Ich hatte ihn drinnen gehalten, ich hatte mich drinnen gehalten und ich war immer wärmer geworden, so heiß wie die Luft und darüber hinaus.
Dann wurde alles schwarz und ich sank vor mir auf den Tisch. Ich wachte auf deiner warmen Handfläche auf, die mich ins Krankenhaus brachte. Sie sprach für mich. Scheu und leise erzählte ich mir dabei schlimme Sachen in immer engeren Kreisen und plötzlich verloren sie ihre Bahn und knallten der Krankenschwester an den Kopf. Am Abend sank ich zu Hause im Mückennetz zusammen und alles war wieder still.
Mein Blick wird engmaschig, ich bin im Netz wie ein Fisch. Nur manchmal schiebst du mich auf dem Stuhl durchs Zimmer als hätte ich keine Beine mehr und stattdessen eine geblümte Schwanzflosse. Vielleicht rammen wir ja jemanden. Du hast mich weinen sehen und wie ich in den Mundschutz geschnaubt habe. Ich zappele im Netz, das lockere Falten schlägt wie ein Brautschleier, der fürs Foto drapiert wurde. Ich bin wieder lebendig.
Jetzt schäle ich mich aus dem Netz und sehe wieder Tiefe. Das Licht ist wieder an. Und auf allem liegt so ein stolzer Schimmer, ein ruhig lächelndes Glimmen.
Und wir sind immer noch zu Hause.
Preis in der Kategorie Jugend: "Der Stern irrt sich" von Sheeren Sayda
Da war er wieder, der Morgen, und schon wieder dieser Alarm. Um 7:00 Uhr klingelt er in meinen Ohren, als hätte er die Absicht mein Innenohr auseinanderzunehmen. Außerdem warum muss es immer wieder um Punkt 7 Uhr morgens klingeln? Warum nicht fünf nach sieben? Warum nicht sieben nach fünf ? Wozu das Pünktliche? Erneut die gleiche Fragen und gleiche Verzweiflung kommen sobald das Bewusstsein erwacht. Andauernd auch die Fragen, die sich ähneln. Aber so ist es wenn man keinen anderen hat um zu sprechen, außer sich selbst. Wenn man keinen anderes Gesicht sieht, außer das Seinige welches sich im Spiegel reflektiert, doch auch das nicht mehr, die ganzen Spiegel habe ich schon abgehängt, denn mein Antlitz war mir unerträglich.
Mag sein, dass der Anfang des Tages den Verlauf einer Routine annimmt, heute ist es anders, heute soll auch anders sein. Heute werde ich mir das Leben nehmen. Das Leben, welches mir nichts bedeutet und welchem ich nichts bedeute. Gestern Abend, hat mir ein Stern diese Botschaft mitgeteilt, der sagte von ganz oben, ich sei verlassen, genau so, wie er der zwischen den Wolken allein funkelte. Ich fühlte diesen Stern. Ganz allein diese Funken zu produzieren, die keiner sieht. Mit keinem zu kommunizieren. Es scheint so einfach . Und so ersann ich, dass ich nicht nur verlassen sondern auch sehr blass, sehr mild und abgetönt durch das Leben wandere. Und so tot. Doch ich habe eine Seele, die leuchtet durch und durch in mir drinnen, doch nimmt keiner sie an, sie zieht keinen zu sich. Sie sagen, das die Augen, die sind, welche einen Weg zur Seele öffnen, welche Brücken darstellen. Doch eine Begegnung, Auge zu Auge, muss erst einmal stattfinden, damit die Kommunikation ihren Lauf nimmt.
Eine Tasse Kaffe, ein Computer, Hände, Tasten, Finger welche diesen Tasten eine Bedeutung geben, und ich, mit schwarzen Augen die Uhr erblickend. Dieses Mal gucke ich die Uhr an und warte bis es klingelt. Ihre Klingel wird dieses Mal meine Freiheit ermöglichen. Ich warte und stelle mir die Szene des Todes vor, meine eigene Szene, aus dem Gebäude hinabstürzend, denn dann bin ich da, dann werde ich gesehen.
Ich schaue auf den Tisch und erblicke viele Blätter, die erledigt werden müssen, und der Berg aus diesen Blätter wächst immer weiter an, der Wille zu Sterben wächst in mir zugleich mit. Die Augen, die Augen Anderer, fest an ihre Bildschirme geheftet, die meine suchend, sich nach Etwas sehnend, vielleicht nach den Augen der Anderen. Es wird bald Zeit, Zeit für den Freitod. Mittagszeit. für die anderen bedeutet es Pause, für mich bedeutet es: Das war es. Ich gehe den Korridor hinunter, der Kopf nach unten hängend, das Herz schlägt rasanter mit jedem Schritt, es will zurück, aber wohin zurück? Zum Alltag? Das ist nicht mehr möglich, Diese Kassette immer wieder abzuspielen, ist nicht mehr möglich, nicht jetzt, nicht heute. Heute ist es anders. Heute muss es auch anders sein. Heute werde ich mir das Leben nehmen.
Die Tür des Aufzuges öffnet sich, ich blicke um mich herum, ich bin allein, niemand ist da, keine Stimme hält mich zurück. Ich drücke die Nummer Zwölf, und gucke auf meinen Zeigefinger der den knöpf drückt-anders als ich es mir vorgestellt habe- zittert er nicht, kein bisschen, ganz gewillt drückt er, als wäre er für diese Aufgabe geschaffen, drückt dieser Finger die Nummer Zwölf. Die Türen schließen sich und somit bildet sie ein großer Spiegel vor mir. Verdammt, sage ich und richte meinen Blick woandershin, an die Decke, wo kein Spiegel und auch kein Ich zu sehen sind. Die Augen schließe ich und versenke mich in das Dunkle, denn mich wollte ich nicht sehen, ich wollte von Ihr keinen Abschied nehmen, so unerkannt, auch selbst unerkannt will ich diese Welt verlassen.
Zwei Etagen und der Aufzug hält, eine Dame steigt ein, meine Blicke bleiben dort, wo sie sein sollen. Die Dame drückt Sieben und seufzt ganz tief, so tief, dass ich es hören kann, ihren Atem. Sie atmet so schön, sodass ich mich nach diesem Atem sehne. Ich wusste bis zu diesem Moment nicht, dass auch der Atem eine Melodie hat, eine Melodie, die spricht, die redet und vermittelt. Nach dieser Erkenntnis, versuchte ich meinen Atem, dem Ihren anzupassen, das auch ich an diesem Klang teilnehmen darf, so eine Art Kommunikation. Eine letzte.
Die Dame sagt, ohne ihren Blick oder ihre Körperhaltung zu ändern, ganz gerade, sagt sie zu mir in den Spiegel guckend:„ Dein Kleid“ und dreht sich um „Es ist sehr schön“, fuhr sie fort. Ich gucke sie fassungslos an, während sie ihren Blick dem meinigen entgegensetzt. Sie guckt mich so kräftig an, als wolle sie in mir was suchen, oder war ich diejenige, die in ihr, was suchte. Eine Rettung sah ich, jedoch sagte ich nichts. Skeptisch redete sie weiter: „Aber deine Haare, so geflochten, du hattest sie ja immer Offen getragen. Hätte ich die gleichen Haare gehabt, hätte ich sie immer offen getragen.“
Die siebte Etage, die Türen gehen auf und sie grinst, bevor sie den Aufzug verlässt.
Ich kann es nicht fassen. Wusste diese Dame, wie meine Harre offen aussehen? Wie? Hat sie sich wirklich, das gewünscht, was ich schon habe, nämlich meine Haare ?Der Spiegel ist wieder da und ich traue mich jetzt ihn anzugucken. Ich suche nach dem, was die Dame zu mir sagte. Das Kleid, das jetzt in meinen Augen das Adjektiv „schön“ trägt und die Haare. Detailliert beobachte ich die feinsten Linien meines Körpers und das nimmt mich mit bis zur zwölften Etagen. Der Spiegel verschwindet, sobald die Türen sich öffnen und eine Begrüßung durch den Wind mir entgegenschlägt. Ich gehe automatisch raus, wie ein Roboter, der eine Aufgabe zu erledigen hat. Bestimmt bringen mich meine Füße zum Rand des Abgrundes, mit der Hoffnungen die Freiheit dort zu finden. Unter meinen Füßen stehen jetzt alle. Die Tatsache, dass sie die Gestalt von Armeisen annehmen, wundert mich. Ich nahm einen tiefen Atemzug und hob die Hände, um das Gummi aus meinen Haaren zu lösen. Der Wind bekam jetzt die Chance jede Strähne meines Haares zu umarmen.
Preis in der Kategorie Kinder: "Wir" von Martha Trommer
Original-Einsendung:
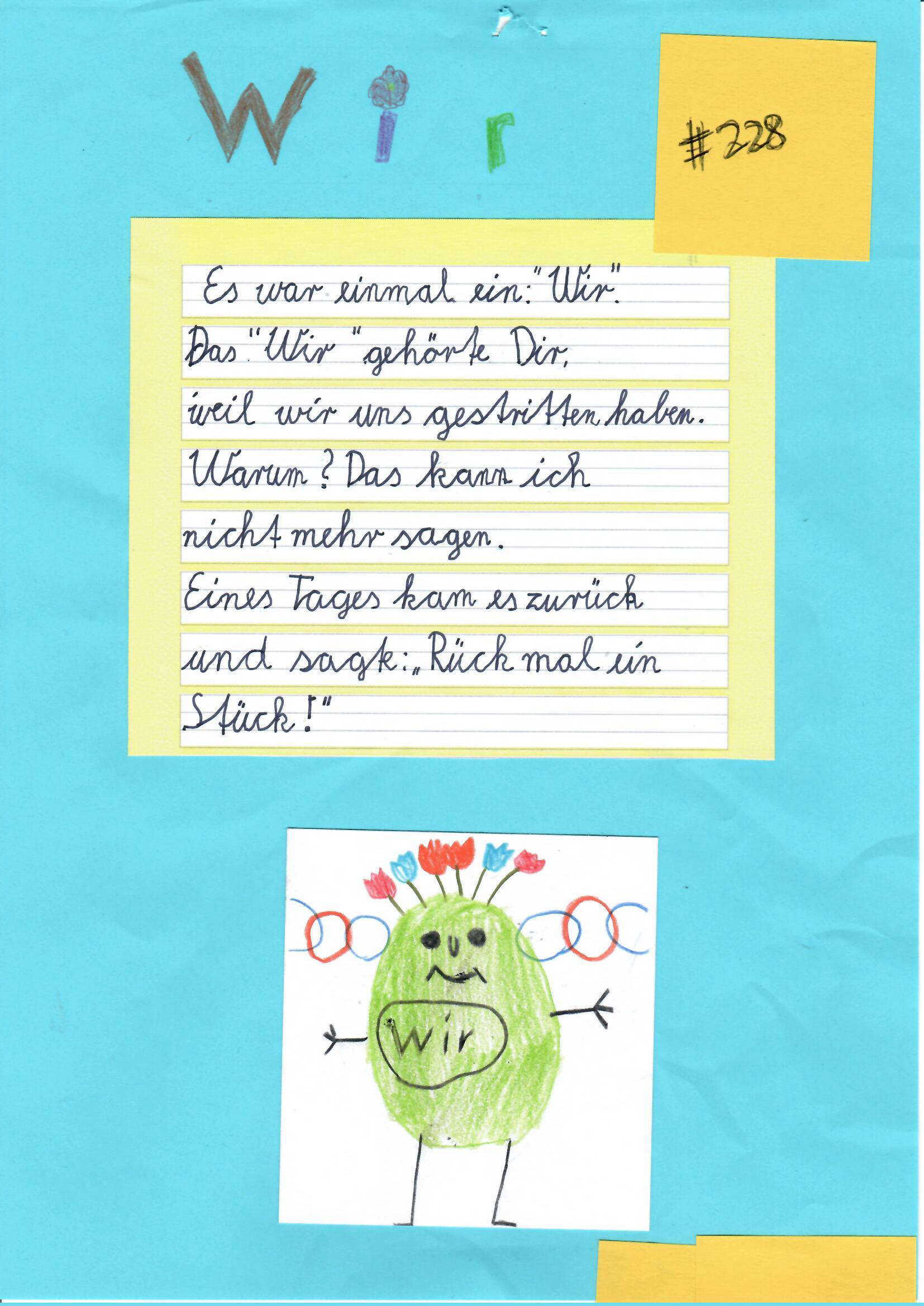
Textversion:
Es war einmal ein: „Wir“.
Das „Wir“ gehörte Dir,
weil wir uns gestritten haben.
Warum?
Das kann ich
nicht mehr sagen.
Eines Tages kam es zurück
und sagte: „Rück mal ein
Stück“!



