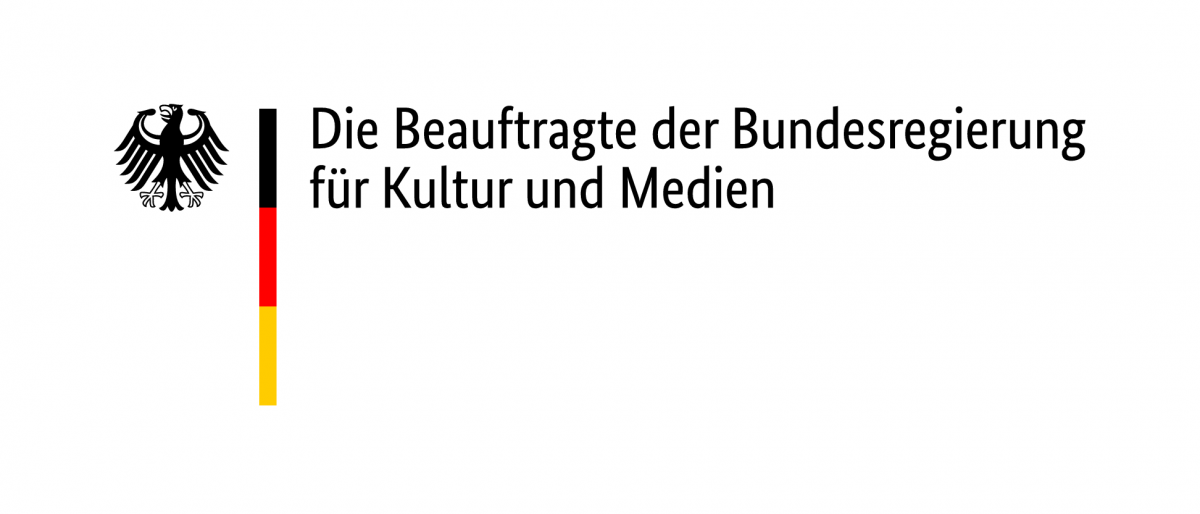Die Liebe und der Tod sind vermutlich die letzten Geheimnisse des Lebens. Und wenn das Leben einen Sinn hat, dann den: diesen Geheimnissen auf die Spur zu kommen. Luises Vater vermutet die Lösung in der Welt draußen und macht sich auf, Spuren in der Fremde zu suchen. Der Optiker sucht in Büchern so etwas wie eine Gebrauchsanweisung für diese beiden Geheimnisse. Der Eis-Italiener schreibt Rezepte mit Namen wie „Kleine heimliche Liebe“ oder „Mittlere Heimliche Liebe“. Es gibt bei ihm auch einen Eisbecher namens „Große Heimliche Liebe“, aber die schafft der Optiker nicht, und auch Luise ist damit überfordert. Frederik hingegen flieht vor den Geheimnissen in die Stille des buddhistischen Klosters, und ein bisschen flieht er auch vor Luise und ihrem Versuch, stundenlang nichts anderes zu tun, als ihn nicht zu küssen. Der Tod hingegen sucht sich ein so rätselhaftes Bild wie das Okapi, das Luises Großmutter Selma von Zeit zu Zeit, eher selten, im Traum erscheint - in den 24 Stunden darauf stirbt dann jemand. Der erste, der starb, war Heinrich, Selmas junger Mann, der das Okapi in einer Zeitung entdeckt hatte und wenig später im Krieg fiel. „Wenn es so etwas gibt wie ein Okapi“, hat Heinrich gesagt, „dann ist alles möglich.“
„Was man von hier aus sehen kann“, von Mariana Leky ist einer der meist gekauften und wohl auch meistgelesenen Romane der letzten Jahre. Die poetische Geschichte um die großen Themen der Literatur - Liebe und Tod - lief im Winter auch als Film in den Kinos. Schon früher nahmen sich die Hamburger Kammerspiele des Stoffes an und schufen ein Theaterstück daraus. Unter der Regie von Dominik Günther spielen Gilla Cremer und Rolf Claussen sämtliche Figuren. Sie tun dies auf eine Weise, die dem Erzählen, der Poesie den Vortritt lässt und aus dem Erzählen heraus die Figuren entstehen lässt. Das birgt, zumal bei zwei Erzkomödianten wie Cremer und Claussen, ein wenig die Gefahr des Extemporierens und Kommentierens, und zu Beginn der Vorstellung in Gauting erliegen sie dem auch schon mal kurz. Doch das mag der Tatsache geschuldet sein, dass die Inszenierung coronabedingt lange pausieren musste und dass ein langer Probentag im bosco hinter den beiden lag. Dem Abend tat dies aber keinen Abbruch. Wenn Gilla Cremer von Großmutter Selma und ihrer besonderen Beziehung zur Enkelin erzählt und sich dann Selmas Sätze wie einen Schal um die Schultern legt; wenn Rolf Claussen von den Selbstzweifeln des Optikers erzählt und dann mit dessen inneren Stimmen kämpft; wenn Cremer von Luise zu Tante Elsbeth und wieder zu Selma wird und Claussen als Frederik staunt und als Luises Vater durch die Welt jagt und als böser Palm den kleinen Martin quält, dann entsteht mitten auf der Bühne ein Okapi, dann ist alles möglich und wird möglich.
Das Okapi erscheint nie grundlos, aber für die Grausamkeit des Todes kann es nichts. Luises bester Freund Martin stirbt, weil er sich an eine nicht richtig geschlossene Regionalzugtür gelehnt hat. Die Regionalzugtür ist in dieser minimalistischen, mit nur sehr wneig Requisiten auskommenden Inszenierung eine längs aufgestellte Bierbank, an deren ausgekappter Seitenstrebe er sich festhält als Martin, der im Zug immer mit geschlossenen Augen aufzählt, was Luise von ihrem Platz aus sehen kann. Als der Unfall geschieht, lässt Claussen los und die Bierbank fällt mit lautem Knall nach hinten. Mit Mitteln wie diesem lässt Regisseur Dominik Günther der Geschichte ihre virtuose Einfachheit, aus der ihre Poesie entsteht. Und ein bisschen ist es wie mit dem wirklichen Leben, das alle Personen der Geschichte so gern verstehen möchten: vielleicht ist es doch nicht mehr als eine vom Tod zusammengestellte Diashow. Aber auch nicht weniger.